„Sagen Sie jetzt nichts“ …
… unter diesem Motto stellt sich die Fachschaft der Gesellschaftswissenschaften (Geschichte/Politik und Gesellschaft) vor. Ihre Mitglieder zeigen die Werte, die uns im Schulalltag wichtig sind und die unser Handeln und Denken prägen.“
Hier gehts zum Beitrag.
Fachschaft Gesellschaftswissenschaften
Geschichte/Politik und Gesellschaft
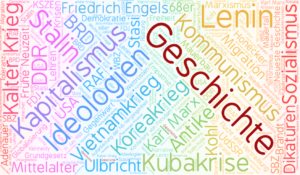

Wussten Sie,
- dass Germering erst am 12. April 1991 das Stadtrecht bekam, aber bereits seit 35.000 Jahren menschliche Aktivitäten auf dem heutigen Stadtgebiet nachweisbar sind?
- dass Germering erstmals 948 beim Tausch eines Bauernhofes als Kermaringun urkundlich erwähnt wurde?
- dass Germering durch den Zuzug von Heimatvertriebenen 1945/46 einen richtig großen Bevölkerungszuwachs bekommen hat?
- dass Germering in den Jahren 1952 und 1954 soziale Wohnungsbauprojekte in für damalige Zeit ungewöhnlicher Größenordnung startete?
Geschichte ist oft näher und greifbarer, als wir es manchmal vermuten. Und eng mit ihr verbunden ist unsere Gesellschaft, in der wir leben. Doch warum ist unsere Gegenwart eben genau so wie sie ist? Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Kann man aus Fehlern der Vergangenheit lernen? Und wie soll unsere Zukunft aussehen? Spiele ich als Individuum bei diesen Fragen überhaupt eine Rolle? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft, welche Rolle werde ich einnehmen und wie kann ich unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten?
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in den Fächern aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, zu denen an der FOS Germering Geschichte in der Jahrgangsstufe 11, Politik und Gesellschaft in der 12. Jahrgangsstufe 12, das Kombifach Geschichte, Politik und Gesellschaft in den Jahrgangsstufen 10 und 13 sowie die Wahlpflichtfächer Soziologie und Internationale Politik gehören.
Die kritische Auseinandersetzung mit geschichtlichen, politischen und soziologischen Themen und historisch gewachsenen Strukturen, die oftmals nachhaltig bis in unsere Gegenwart wirken, helfen uns, Zusammenhänge im (welt-)politischen Geschehen besser zu verstehen und eigene Standpunkte zu entwickeln sowie gesellschaftliches und politisches Leben mitzugestalten. Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sind daher das „Bindeglied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“.

Seminarfach „Macht der Narrative“ – Podcast

ReThink: Projekt zur Demokratieförderung
Im Folgenden finden Sie weiterführende Informationen zu den Wahlpflichtfächern aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften.
Internationale Politik (Wahlpflichtfach)

Beschreibung
Die EU, die USA, China, die UNO, die NATO, Putin, Ukraine, Nahostkonflikt, Klimawandel…
Wer verstehen will, was die Welt bewegt, der ist im Wahlpflichtfach Internationale Politik genau richtig. Wer das Zeitunglesen nicht scheut und sich für die großen Themen der Welt interessiert, der befasst sich in diesem Fach mit Akteuren, Strukturen und Theorien in der internationalen Politik. Die Schülerinnen und Schüler bewerten und analysieren diese. Lösungsansätze zu aktuellen Handlungsfeldern und Herausforderungen in der internationalen Politik werden kritisch betrachtet und Chancen und Risiken abgewogen.
Des Weiteren beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit Kontroversen in der und über die internationale Politik und bewerten Interaktionsmöglichkeiten, analysieren Reden zur Außenpolitik und debattieren aktuelle Problemlagen. Dabei werden die Auswirkungen auf die eigene Lebenswirklichkeit erläutert.
Vorstellung des Projekts „Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“
Eine der größten internationalen Herausforderungen in den kommenden Jahrzehnten ist unbestreitbar der Klimawandel. Gerade die junge Generation hat mit „Fridays for Future“ den dringenden Handlungsbedarf lautstark gefordert, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens überhaupt noch einhalten zu können. Der Jugendrat der Generationenstiftung weist in dem Buch „,Ihr habt keinen Plan – darum machen wir einen!“: 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft‘“(Blessing Verlag 2019) nicht nur auf die Probleme hin, sondern bietet auch zahlreiche Lösungsansätze, um der Klimakrise die Stirn zu bieten.
Hier werden nicht nur die Folgen des Klimawandels und der Ökozid beleuchtet, sondern auch andere Fragestellungen thematisiert, die ebenso Herausforderungen für die internationale Politik sind: Wie sichern wir langfristig die Demokratie und Menschenrechte? Wie verändert sich das 21. Jahrhundert durch die Digitalisierung? Wie erreichen wir globale Gerechtigkeit? Wie müssen sich wirtschaftliche Strukturen verändern, um den Wohlstand zu sichern?
Die Schüler/innen des Wahlpflichtfaches haben sich im Projekt „Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ mit diesen Themen sowie den Lösungsvorschlägen des Jugendrates der Generationenstiftung kritisch auseinandergesetzt und die Ergebnisse in Präsentationen festgehalten.
Im Folgenden befindet sich eine Auswahl der Präsentationen, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Meere und dem Rückgang der Biodiversität beschäftigen. Ebenso wurde sich kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Staat die Wirtschaft stärker regulieren muss, um den Wohlstand zu sichern.
Soziologie (Wahlpflichtfach)
Wie funktioniert unsere Gesellschaft und welche Rolle spiele ich darin?
Wer wissen will, in welche Rollen der Mensch schlüpft, um sich in einer Gruppe zu behaupten und wie er durch sein Verhalten Teil der Gesellschaft wird, ist im Wahlpflichtfach Soziologie genau richtig. Denn hier befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Rolle des Individuums in der Gesellschaft. Die Bedeutung von sozialem Handeln und Individualisierung wird analysiert und diskutiert.
Ein weiteres Lernfeld ist die Heterogenität der Gesellschaft, bei dem unter anderem soziale Ungleichheit thematisiert und Ursachen und Lösungsversuche kritisch diskutiert werden. Fragen wie „Wie arbeiten und leben wir in 50 Jahren?“ werden im Lernbereich „Gesellschaft im Wandel“ aufgegriffen und ermöglichen einen Blick in unsere Zukunft.








